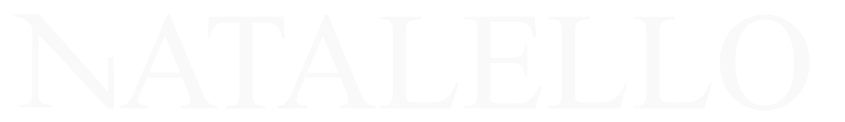Wer am Wirtschaftsleben teilnimmt, begegnet früher oder später der Frage, ob er oder sie im rechtlichen Sinne als Kaufmann gilt. Diese Einordnung ist weit mehr als ein akademisches Etikett: Sie entscheidet darüber, ob das allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) oder das speziellere Handelsgesetzbuch (HGB) anwendbar ist – mit teils erheblichen Folgen für Fristen, Beweislasten und Formvorgaben. Gerade mittelständische Unternehmen und Selbständige im Rhein-Main-Gebiet wenden sich regelmäßig an unsere Kanzlei Hobohm Natalello Giloth, um Rechtssicherheit zu erhalten. Nachstehend erläutern wir daher, welche Kriterien der Gesetzgeber aufstellt, wie sich die einzelnen Kaufmanns-Typen voneinander unterscheiden und welche praktischen Auswirkungen dies im Alltag hat.
Das Handelsrecht gehört zwar dogmatisch zum Privatrecht, enthält aber etliche öffentlich-rechtliche Einschläge, etwa im Bereich des Wettbewerbs- oder Gewerberechts. Sein Kernanliegen ist es, den gesteigerten Anforderungen des Geschäftsverkehrs Rechnung zu tragen: Wer professionell am Markt agiert, muss sich auf rasche Abläufe, verkürzte Rügefristen und ein hohes Maß an Vertrauensschutz verlassen können. § 377 HGB verpflichtet beispielsweise zur unverzüglichen Untersuchung eingehender Waren und begründet bei Säumigkeit den Verlust von Gewährleistungsrechten. In ähnlicher Weise erlauben § 353 HGB die pauschale Verzinsung von Geldforderungen unter Kaufleuten, während § 15 HGB Dritte schützt, die auf den Verlautbarungen des Handelsregisters vertrauen.
Von all diesen Privilegien – und auch Pflichten – profitieren beziehungsweise leiden jedoch nur diejenigen, die das Gesetz ausdrücklich als Kaufmann anspricht. Maßgeblich sind die §§ 1 ff. HGB. Sie unterscheiden den Ist-, Kann-, Form-, Fiktiv- und den sogenannten Scheinkaufmann. Eine genaue Einordnung verhindert teure Fehler: Übersieht ein Gewerbetreibender seine Kaufmannsstellung, läuft er Gefahr, Fristen zu versäumen oder unbewusst handelsrechtliche Vertragsklauseln auszulösen. Umgekehrt kann die bewusste Entscheidung, Kaufmann zu werden, etwa durch Eintragung im Handelsregister, den unternehmerischen Handlungsspielraum beträchtlich erweitern.
Istkaufmann (§ 1 HGB)
Als Istkaufmann qualifiziert das Gesetz jede Person, die ein Handelsgewerbe betreibt. Handelsgewerbe ist wiederum jedes planmäßig und auf gewisse Dauer angelegte Gewerbe, das auf Gewinnerzielung gerichtet ist, am Markt offen auftritt, rechtlich selbständig ausgeübt wird und weder freie Berufsausübung noch reine Vermögensverwaltung darstellt. Entscheidend ist darüber hinaus, dass Art und Umfang des Betriebs eine kaufmännische Organisation erfordern. Umsatzhöhe, Zahl der Mitarbeiter, Inanspruchnahme von Krediten oder die Notwendigkeit doppelte Buchführung zu führen, können hier Indizien sein. Wer sämtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt, wird kraft Gesetzes Kaufmann – unabhängig davon, ob er im Handelsregister steht. Die Eintragung wirkt insoweit rein deklaratorisch.
Kleingewerbe und Kannkaufmann (§§ 2, 3 HGB)
Erreicht das Unternehmen die Schwelle zum Handelsgewerbe noch nicht, spricht man vom Kleingewerbetreibenden. Dieser kann sich freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen und wird durch die Eintragung konstitutiv Kaufmann. Ebenso räumt § 3 HGB Land- und Forstwirten das Wahlrecht ein, sich bei entsprechender Betriebsgröße als Kaufmann registrieren zu lassen. Beachten sollte man, dass das Wahlrecht mit der erstmaligen Eintragung verbraucht ist; wer sich einmal bewusst für den kaufmännischen Status entschieden hat, bleibt daran gebunden, bis der Betrieb eingestellt wird.
Formkaufmann (§ 6 HGB)
Personen- und Kapitalgesellschaften genießen einen Sonderstatus: Offene Handels- und Kommanditgesellschaften werden bereits mit Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit, Kapitalgesellschaften erst mit Eintragung ins Handelsregister Kaufmann kraft Rechtsform. Geschäftsführer oder Gesellschafter werden dadurch nicht persönlich handelsrechtlich verpflichtet – Kaufmann ist ausschließlich die Gesellschaft. Gleichwohl haften sie für Pflichtverletzungen, etwa fehlerhafte Registerangaben, nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen.
Fiktivkaufmann (§ 5 HGB)
§ 5 HGB verhindert, dass jemand sein Handelsregisterunternehmen als Nicht-Handelsgewerbe deklariert, um sich den schärferen Normen des HGB zu entziehen. Besteht ein Registereintrag, wird Kaufmannseigenschaft vermutet – selbst wenn der tatsächliche Geschäftsbetrieb die Schwelle zum Handelsgewerbe nicht (mehr) erreicht. Die praktische Relevanz dieser Vorschrift ist zwar durch § 2 HGB geschrumpft, in der Beratungspraxis bleibt sie jedoch unverzichtbar: Wer die Firma einer früheren Kapitalgesellschaft fortführt, ohne das Register zu löschen, unterliegt vollumfänglich den handelsrechtlichen Vorschriften.
Scheinkaufmann (Rechtsprechungsgrundsatz)
Schließlich schützt die Rechtsordnung auch den guten Glauben des Geschäftsverkehrs. Wer nach außen den Anschein erweckt, Kaufmann zu sein – etwa durch die Verwendung einer handelsrechtlich anmutenden Firmenbezeichnung oder das Auftreten mit kaufmännischen Vollmachten – muss sich an diesem Rechtsschein festhalten lassen. Zwar entsteht dadurch keine Kaufmannseigenschaft „per se“, doch werden die entsprechenden Normen im Verhältnis zu gutgläubigen Dritten angewandt. Voraussetzung ist stets, dass der Rechtsschein zurechenbar gesetzt, vom Vertragspartner gutgläubig aufgenommen und kausal für dessen Entscheidung war. Für Minderjährige oder Geschäftsunfähige greift dieser Mechanismus nicht, da das Schutzniveau der §§ 104 ff. BGB Vorrang hat.
Unternehmerbegriff im Verbraucherrecht
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Abgrenzung zum Unternehmerbegriff des § 14 BGB, der unionsrechtlichen Ursprungs ist. Unternehmer ist, wer bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Das kann jede freiberuflich tätige Person sein, auch wenn sie nicht Kaufmann ist. Die Zielrichtung ist hier der Verbraucherschutz: Das BGB schafft Informations- und Widerrufsrechte, um das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Unternehmer und Verbraucher auszugleichen. Das Handelsrecht setzt andere Schwerpunkte, nämlich Effizienz und Vertrauen im Geschäftsverkehr. In der Praxis müssen daher regelmäßig zwei Ebenen geprüft werden – die verbraucherschutzrechtliche und die handelsrechtliche.
Rechtsfolgen im Überblick
Ist die Kaufmannseigenschaft bejaht, gelten unter anderem die Rügeobliegenheit des § 377 HGB, die Vorschriften über Prokura (§§ 48 ff. HGB), die strengeren Formanforderungen an Handelsbräuche (§ 346 HGB) und spezialisierte Haftungstatbestände. Auch fristenrechtlich setzt das Handelsrecht andere Akzente: Mahnungen können verkürzt werden, Zinsen laufen schneller auf. Aus Unternehmersicht bringt das Vorteile, erfordert aber zugleich eine sauber geführte Buchhaltung und ein hohes Maß an Compliance. Fehlt es an personellen Ressourcen oder Expertise, drohen kostspielige Versäumnisse.
Handlungsempfehlungen für die Praxis
Unternehmen sollten regelmäßig überprüfen, ob ihr Wachstum oder eine Umstrukturierung den Übergang vom Kleingewerbe zum Handelsgewerbe bewirkt. Ebenso wichtig ist eine korrekte Registerführung: Veränderte Firma, Sitz oder Rechtsform müssen unverzüglich angemeldet werden, um Haftungsfallen zu meiden. Wer bewusst auf die Eintragung verzichtet, behält zwar gewisse Spielräume, riskiert aber, als Scheinkaufmann behandelt zu werden, wenn Außendarstellung und Geschäftsumfang ein anderes Bild zeichnen. Gerade Gründer in Mainz und Alzey profitieren von einer frühzeitigen Beratung, um die Weichen richtig zu stellen. Unsere Kanzlei begleitet Sie dabei nicht nur rechtlich, sondern behält auch betriebswirtschaftliche Aspekte im Blick.
Fazit
Die Kaufmannseigenschaft ist das Eintrittstor in das Sonderprivatrecht des Handelsgesetzbuchs. Sie entsteht kraft Gesetzes, freiwilliger Eintragung oder aufgrund der Rechtsform – in manchen Fällen allein durch das Auftreten am Markt. Wer ihre Reichweite unterschätzt, riskiert unnötige Haftung und entzieht sich womöglich vorteilhaften handelsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Eine fundierte rechtliche Prüfung schafft Klarheit und bildet die Basis für langfristig erfolgreiche Geschäftsentscheidungen. Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie Ihre Stellung im Wirtschaftsverkehr präzise bestimmen oder anpassen möchten.
Ihre Ansprechpartner
Rechtsanwältin Sinem Tükek und Rechtsanwalt Dr. André Natalello
Jetzt Kontakt aufnehmen
Telefon: 06131-9725322
E-Mail: info@hng.law
Standorte: Mainz | Alzey
Termine nach Vereinbarung – auch kurzfristig möglich
Hobohm Natalello Giloth – Rechtsanwälte seit 1959
Terminvereinbarung
Terminvereinbarungen mit der Kanzlei sind unproblematisch auch per WhatsApp möglich. Bitte beachten Sie jedoch, dass über WhatsApp ausschließlich die Terminvereinbarung erfolgt.
KONTAKTFORMULAR
Zur Vereinbarung eines Termins mit der Kanzlei Hobohm Natalello Giloth können Sie im Übrigen auch das Kontaktformular verwenden. So kommen Sie schnell und einfach zu Ihrem Termin in der Kanzlei
Selbstverständlich können Sie Termine mit Ihrem Anwalt auch per E-Mail vereinbaren. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail bietet es sich an, wenn Sie den Sachverhalt bereits grob skizzieren.