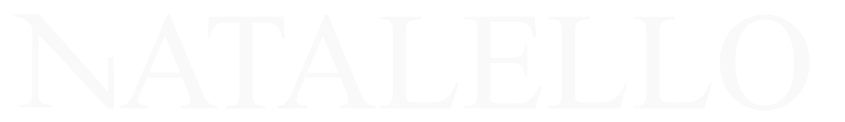Gesellschafterversammlung in der GmbH
Die Gesellschafterversammlung ist das zentrale Willensbildungsorgan der GmbH, auch wenn viele Entscheidungen im täglichen Geschäft auf Geschäftsführerebene getroffen werden. Im Rahmen der Gesellschafterversammlung üben die Gesellschafter ihre Rechte durch Beschlüsse aus. Die Anwaltskanzlei Hobohm Natalello Giloth in Mainz begleitet Gesellschaften, Geschäftsführungen und Gesellschafter bei Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gesellschafterversammlungen. Selbstverständlich auch einschließlich streitiger Beschlussfassungen und gerichtlicher Durchsetzung.
In den nachfolgenden Ausführungen informiert Rechtsanwalt Dr. Natalello über typische Fragestellungen im Zusammenhang mit Gesellschafterversammlungen:
Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung
Der Umfang der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung richtet sich in erster Linie nach dem Gesellschaftsvertrag (§ 45 GmbHG). § 46 GmbHG enthält einen – abänderbaren – Katalog von Regelfällen. Danach entscheidet die Versammlung insbesondere über:
– das Einfordern von Einzahlungen auf die Stammeinlagen,
– die Rückgewähr von Nachschüssen,
– Teilung und Einziehung von Geschäftsanteilen,
– Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer,
– Maßnahmen zur Kontrolle der Geschäftsführung,
– Bestellung von Prokuristen sowie Handlungsbevollmächtigten für den Gesamtbetrieb,
– die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft aus Gründung oder Geschäftsführung gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter sowie über die Prozessvertretung der Gesellschaft gegenüber Geschäftsführern.
Zwingend in der Gesellschafterversammlung zu entscheiden sind u. a.:
– Einforderung von Nachschüssen (§ 26 GmbHG),
– grundlegende Strukturmaßnahmen (Satzungsänderungen, Kapitalmaßnahmen),
– Auflösung, Verschmelzung und Umwandlung.
Besonderer Bedeutung kommt dem umfassenden Weisungsrecht gegenüber den Geschäftsführern auch in Fragen des operativen Tagesgeschäfts (§ 37 GmbHG). Das unterscheidet die GmbH von der AG oder Genossenschaft, deren Haupt‑ bzw. Generalversammlung keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Vorstand besitzt (§ 76 AktG). In der Praxis enthalten Gesellschaftsverträge regelmäßig Kataloge zustimmungsbedürftiger Geschäfte (z. B. Investitionen, Finanzierungen, Verträge ab bestimmten Schwellen). Üblich ist weiterhin, dass die Versammlung die von der Geschäftsführung erstellten Jahresbudgets (Umsatz, Ergebnis, Investitionen, Finanzierung) vor Geschäftsjahresbeginn genehmigt. In mitbestimmten GmbHs ist die Bestellung der Geschäftsführer gesetzlich der Versammlung entzogen (§§ 25, 31 MitbestG; § 12 MontanMitbestG).
Einberufung der Gesellschafterversammlung
Die Einberufung erfolgt durch die Geschäftsführer (§ 49 Abs. 1 GmbHG). Bei mehreren Geschäftsführern ist jeder einzelvertretungsberechtigt, auch wenn Gesamtvertretung besteht. Ein originäres Einberufungsrecht der Gesellschafter besteht nur, wenn dies die Satzung vorsieht oder die Geschäftsführer ihrer Einberufungspflicht nicht nachkommen (§ 50 Abs. 3 GmbHG). Eine Pflicht zur Einberufung besteht u. a., wenn
– über den Jahresabschluss zu beschließen ist,
– es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist (§ 49 Abs. 2 GmbHG), etwa bei Verlust der Hälfte des Stammkapitals (§ 49 Abs. 3 GmbHG),
– der Gesellschaftsvertrag dies vorsieht,
– Gesellschafter mit mindestens 10 % des Stammkapitals die Einberufung verlangen (§ 50 Abs. 1 GmbHG).
Einberufungsfrist
Die Form und Frist der Einberufung ergeben sich aus § 51 GmbHG. Auch insoweit sind jedoch Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen möglich. Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss die Ladung mindestens eine Woche vorher bewirkt sein. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des typischerweise zu erwartenden Zugangs; zur Frist sind die üblichen Zustellzeiten zu addieren. Inlandszustellungen sollten erfahrungsgemäß mit zwei Tagen, Auslandszustellungen je nach Staat mindestens mit vier Tagen kalkuliert werden. Vom Einberufungszeitpunkt ist die Mitteilung der Tagesordnung zu unterscheiden (§ 51 Abs. 2, 4 GmbHG): Sie soll mit der Einladung erfolgen und muss spätestens drei Tage vor der Versammlung bekannt sein. Wird diese Frist verfehlt, sind Beschlüsse zu nachträglich aufgenommenen Punkten nur im Rahmen einer Universalversammlung möglich. Satzungen enthalten häufig strengere Sonderregelungen – diese können wirksam sein und sind im Einzelfall auszulegen. Meine Meinung: Für Rechtssicherheit empfiehlt sich eine satzungskonforme „Zweifristen-Logik“ (Einladung + separate Agenda-Frist) und eine klare Regel zur Ergänzung der Tagesordnung.
Ort der Gesellschafterversammlung
Regelmäßig tagt die Versammlung am Sitz der Gesellschaft; gemeint ist die Gemeinde, nicht zwingend die Geschäftsräume. Beschlüsse können schriftlich gefasst werden (§ 48 Abs. 2, 3 GmbHG). In der Praxis sind – soweit dispositiv – Umlaufbeschlüsse sowie Verfahren per Telefax oder E‑Mail weit verbreitet; pandemiebedingte Sonderregelungen sind ausgelaufen. Ob digitale oder hybride Formate zulässig sind, entscheidet der Gesellschaftsvertrag.
Form der Einberufung
Die Ladung erfolgt grundsätzlich per eingeschriebenem Brief (§ 51 Abs. 1 GmbHG). Die herrschende Meinung lässt hierbei ein Einwurfeinschreiben genügen. Es erscheint jedoch im Rahmen einer modernen Satzung sinnvoll, hier die Vorgaben zu präzisieren. Alle Gesellschafter sind zu laden – auch bei fehlendem Stimmrecht –, andernfalls droht Nichtigkeit. Die Tagesordnung muss die Beschlussgegenstände so konkret benennen, dass eine sachgerechte Vorbereitung möglich ist; zu pauschale Angaben („Geschäftsführungsmaßnahmen“) genügen nicht. Als ausreichend bestimmt gilt regelmäßig der Agendapunkt „Abberufung des Geschäftsführers“; damit kann – sofern so angekündigt – auch über die Abberufung aus wichtigem Grund entschieden werden. Wird hingegen „Abberufung aus wichtigem Grund“ angekündigt, rechtfertigt dies nicht ohne Weiteres eine ordentliche Abberufung. Empfehlenswert ist daher die ausdrückliche Ankündigung einer hilfsweisen ordentlichen Abberufung, soweit beide Varianten in Betracht kommen. Eine Ergänzung der Tagesordnung ist bis drei Tage vor der Versammlung zulässig (§ 51 Abs. 4 GmbHG).
Zur Form: Das Einwurf‑Einschreiben wird in der Praxis meist akzeptiert; der sicherste Weg bleibt das Übergabeeinschreiben. Auch E‑Mail‑Einladungen können – bei rechtzeitigem Zugang und vollständiger Information – wirksam sein; aus Beweis‑ und Datenschutzgründen ist gleichwohl Vorsicht geboten. Je nach Tagesordnung können zusätzliche Unterlagen (z. B. Entwurf des Jahresabschlusses) beizufügen sein.
Ablauf der Gesellschafterversammlung
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Gesellschafter, unabhängig von einem etwaigen Stimmrechtsausschluss. Vertretung ist mit schriftlicher Vollmacht zulässig (§ 47 Abs. 3 GmbHG); häufig beschränkt die Satzung die Vertretung auf Mitgesellschafter oder zur Verschwiegenheit verpflichtete Berufsträger. Die Teilnahme von Beratern ist ohne satzungsmäßige Grundlage grundsätzlich nicht gestattet; aus Treuepflichtgründen kann im Einzelfall eine Duldung geboten sein, insbesondere bei komplexen oder streitigen Entscheidungen. Geschäftsführer haben kein Teilnahmerecht kraft Gesetzes, können aber zur Teilnahme verpflichtet oder aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden; umgekehrt können Nichtgesellschafter mit Mehrheit zugelassen werden.
Rechte und Pflichten des Versammlungsleiters
Das GmbH‑Gesetz ordnet keinen Versammlungsleiter an. Schweigt die Satzung, wählt die Versammlung mit einfacher Mehrheit eine Leitung. Der Leiter bestimmt die Reihenfolge der Tagesordnung, setzt das Abstimmungsverfahren fest und stellt Beschlussergebnisse fest. Mit der Feststellung erlangt der Beschluss vorläufige Wirksamkeit; ohne förmliche Feststellung bleibt der Vollzug bis zum Abschluss eines Anfechtungsverfahrens gehemmt. Kann oder will der satzungsmäßig bestimmte Leiter eine Sitzung nicht führen, ist eine (auch temporäre) Niederlegung und Neuwahl möglich. Umstritten ist die Abberufung gegen den Willen des Leiters; hier sind Satzung, Mehrheiten und etwaige wichtige Gründe sorgfältig zu prüfen. Zwischen Leiter und GmbH entsteht durch die Amtsübernahme ein schuldrechtliches Verhältnis; Pflichtverletzungen können Schadensersatz auslösen. Haftungsbegrenzungen sind – soweit zulässig – empfehlenswert. Meine Meinung: In streitgeneigten Konstellationen sollte die Sitzungsleitung stets professionell und neutral besetzt werden, um Anfechtungsrisiken zu minimieren.
Beschlussfähigkeit
Gesetzlich ist bereits das Erscheinen eines einzigen geladenen Gesellschafters ausreichend. Praktisch sehen Satzungen Quoren vor (Anwesenheit oder qualifizierte Mehrheiten der „vorhandenen“ Stimmen). Üblich ist eine Regelung, wonach eine zweite Versammlung unabhängig von der Präsenz beschlussfähig ist; die Einladung zu einer „Eventual‑Zweitversammlung“ bereits im Erstschreiben ist hingegen unzulässig. Ob in der Zweitversammlung nur die bereits angekündigten Punkte behandelt werden dürfen, ist umstritten. Sachgerecht ist eine Ergänzung zulässigerweise – für neue Punkte gelten dann die Quoren wie bei einer Erstversammlung.
Rederecht der Gesellschafter
Alle Gesellschafter haben das Recht, sich zu äußern und Anträge zu stellen; das gilt auch bei Stimmrechtsausschlüssen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.
Beschlussfassung
Grundsatz ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen (§ 47 Abs. 1 GmbHG). Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen, nicht nach Köpfen. Für Satzungsänderungen u. a. gelten höhere Quoren (§ 53 Abs. 2 GmbHG). Stimmverbote sind in § 47 Abs. 4 GmbHG angelegt (Insichgeschäft; Richten in eigener Sache), erfassen aber nicht alle Konfliktlagen und gelten z. B. nicht in der Ein‑Mann‑GmbH oder bei sogenannten Sozialakten (z. B. Geschäftsführerbestellung, Vergütung). Umgehungen sind unzulässig; Näheverhältnisse (Ehegatten, Kinder) begründen für sich genommen kein Stimmverbot. Davon zu unterscheiden ist das Ruhen der Stimmrechte bei von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Anteilen (entsprechend § 71b AktG) sowie bei treuhänderischer oder konzernabhängiger Haltung.
Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen
Mangels ausdrücklicher Regelungen im GmbHG werden für Nichtigkeit und Anfechtung die aktienrechtlichen Vorschriften analog herangezogen (§§ 241 ff., 246 ff. AktG).
Nichtigkeit
Schwerwiegende Mängel führen zur Nichtigkeit ex tunc. Typische Fälle sind:
– Einberufungsmängel (z. B. Einladung durch Unzuständige, Nichtladung einzelner Gesellschafter),
– fehlende notarielle Beurkundung bei satzungsändernden, satzungsdurchbrechenden oder umwandlungsrechtlichen Beschlüssen sowie Unternehmensverträgen,
– wesensfremde oder schutzrechtswidrige Beschlüsse (Eingriff in unentziehbare Individual‑ oder Gläubigerrechte),
– Feststellung eines nichtigen Jahresabschlusses.
Die Nichtigkeit kann grundsätzlich jederzeit geltend gemacht werden. Heilung tritt – bei eintragungspflichtigen Beschlüssen – spätestens nach drei Jahren seit Registereintragung ein (analog § 242 Abs. 2 AktG), es sei denn, eine Nichtigkeitsklage (analog § 249 AktG) wird rechtzeitig erhoben. Unabhängig davon kann die Nichtigkeit im Wege der Feststellungsklage geklärt werden; richtiger Beklagter ist stets die Gesellschaft.
Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen
Fehlerhafte, aber nicht nichtige Beschlüsse sind wirksam, solange sie nicht durch rechtskräftiges Urteil aufgehoben werden. Die Anfechtungsklage ist – in Anlehnung an § 246 AktG – binnen eines Monats zu erheben; starre Fristen gelten nicht in jedem Detail, doch empfiehlt sich strikt fristwahrendes Vorgehen. Beklagte ist die Gesellschaft; Mitgesellschafter können als Nebenintervenienten beitreten und das Verfahren aktiv mitgestalten. Anfechtungsgründe sind insbesondere:
– Verstöße gegen Gesellschaftsvertrag oder zwingendes GmbH‑Recht,
– Verletzung der gesellschafterlichen Treuepflicht,
– Stimmrechtsmissbrauch,
– Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot,
– Missachtung von Stimmverboten,
– Versammlungen an Orten, die faktisch die Teilnahme von Gegnern unzumutbar erschweren (z. B. in Räumen eines verfeindeten Gesellschafters).
Sie planen eine Gesellschafterversammlung oder möchten Beschlüsse rechtssicher vorbereiten bzw. anfechten? Unsere auf Wirtschafts‑ und Gesellschaftsrecht spezialisierte Kanzlei in Mainz berät Sie schnell, diskret und mit nachweislicher Prozess‑ und Gestaltungserfahrung.
Terminvereinbarung
Terminvereinbarungen mit der Kanzlei sind unproblematisch auch per WhatsApp möglich. Bitte beachten Sie jedoch, dass über WhatsApp ausschließlich die Terminvereinbarung erfolgt.
KONTAKTFORMULAR
Zur Vereinbarung eines Termins mit der Kanzlei Hobohm Natalello Giloth können Sie im Übrigen auch das Kontaktformular verwenden. So kommen Sie schnell und einfach zu Ihrem Termin in der Kanzlei
Selbstverständlich können Sie Termine mit Ihrem Anwalt auch per E-Mail vereinbaren. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail bietet es sich an, wenn Sie den Sachverhalt bereits grob skizzieren.