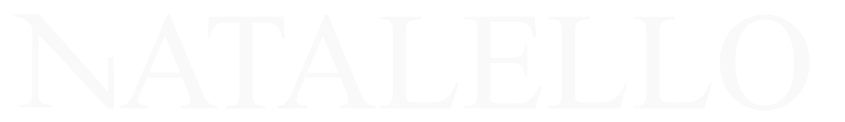Stellvertretung im Handelsrecht: Prokura, Handlungsvollmacht und Rechtsschein umfassend erklärt
Die kaufmännische Stellvertretung bildet das Rückgrat des modernen Wirtschaftslebens. Ohne rechtssichere und zugleich praktikable Vertretungsregeln könnten mittelständische Betriebe, Konzerne und Start-ups ihren täglichen Geschäftsverkehr kaum bewältigen. Das Handelsgesetzbuch (HGB) enthält deshalb ein fein austariertes System aus Prokura, Handlungsvollmacht und besonderen Rechtsscheintatbeständen (§§ 48 ff., 54 ff., 55, 56 HGB). Diese Normen füllen die Lücken des allgemeinen Stellvertretungsrechts der §§ 164 ff. BGB, indem sie typisierte Vollmachtsformen schaffen, den Vertrauensschutz gutgläubiger Dritter stärken und zugleich ein Mindestmaß an Transparenz und Kontrolle sicherstellen. Der folgende Beitrag beleuchtet die handelsrechtlichen Besonderheiten auf rund 2 500 Wörtern und zeigt auf, worauf Unternehmer, Geschäftsführer und Rechtsberater in der Praxis besonders achten müssen.
1. Systematischer Rahmen: BGB-Vertretung versus HGB-Vollmacht
Ausgangspunkt jeder Stellvertretung ist § 164 BGB. Danach bindet eine Willenserklärung, die ein Vertreter im Namen des Vertretenen innerhalb seiner Vertretungsmacht abgibt, unmittelbar den Geschäftsherrn. Im kaufmännischen Verkehr reichen diese Grundsätze jedoch nicht aus: Zum einen besteht ein gesteigertes Bedürfnis nach Schnelligkeit und Professionalität, zum anderen verlangt der Massengeschäftsverkehr verlässliche äußere Anhaltspunkte für die Vertretungsmacht. Das HGB reagiert darauf mit zwei Leitprinzipien.
- Typisierung: Anstelle individueller Einzelfallprüfungen statuiert das Gesetz bestimmte Vollmachtsgattungen mit gesetzlich festgelegtem Umfang, vor allem die Prokura.
- Publizität: Über das Handelsregister (§ 9 HGB) und die gesetzlich vermuteten Ladenvollmachten (§ 56 HGB) werden Rechtsscheinsituationen geschaffen, auf die sich Dritte verlassen dürfen.
Wer das System verstehen will, muss deshalb stets dreifach denken: (1) Gibt es eine ausdrückliche oder konkludente Vollmacht? (2) Greift ein gesetzlicher Rechtsschein, der die Vollmacht fingiert oder erweitert? (3) Liegt ein Missbrauch oder Erlöschensgrund vor, der die Vertretungsmacht beseitigt, ohne den Vertrauensschutz Dritter auszulöschen?
2. Die Prokura – Königin der handelsrechtlichen Vollmachten
2.1 Erteilungsvoraussetzungen
Prokura kann nur ein Kaufmann im handelsrechtlichen Sinne erteilen (§ 48 Abs. 1 HGB). Das schließt sowohl Formkaufleute – etwa die GmbH oder AG – als auch Ist- und Kannkaufleute ein. Die Erteilung erfordert eine ausdrückliche Willenserklärung; reine Duldung oder konkludentes Verhalten genügen nicht, weil die Prokura nach ihrem gesetzgeberischen Konzept höchste Vollmacht ist und nur mit vollem Bewusstsein verliehen werden soll. Gleichwohl kann das dauerhafte Dulden eines Handelns „im Namen der Prokura“ Rechtsscheinfolgen auslösen – der BGH hat mehrfach eine Haftung des Kaufmanns aus Handlungsvollmacht oder Anscheinsvollmacht angenommen, wenn er die Situation über längere Zeit geschehen ließ. Wichtig bleibt: Eine Duldungsprokura kennt das Gesetz nicht; der Begriff taucht dennoch in der Beratungspraxis auf, ist aber exakt genommen ein unscharfer Kurzschluss zweier Institute.
Die Eintragung im Handelsregister ist nur deklaratorisch (§ 53 Abs. 1 HGB). Gleichwohl sollte sie unverzüglich erfolgen, weil sie den Rahmen für den gutgläubigen Geschäftsgegner absteckt. Unterlässt der Kaufmann die Anmeldung, kann er sich nach § 15 Abs. 1 HGB nicht darauf berufen, die Prokura sei nie erteilt worden oder bereits erloschen.
2.2 Umfang der Prokura
Der Gesetzgeber formuliert in § 49 Abs. 1 HGB denkbar weit: Der Prokurist ist zu „allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen befugt, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt.“ Entscheidend ist also nicht, ob das konkrete Geschäft im typischen Geschäftsfeld der Firma liegt, sondern ob es abstrakt-generell als kaufmännisch erscheint. Damit kann ein Prokurist einer Holz-OHG durchaus auch EDV-Dienstleistungen einkaufen – und sogar eine Beteiligung an einem fremden Start-up zeichnen, sofern dies kaufmännisch nachvollziehbar wirkt.
Gesetzliche Ausnahmen relativeren diesen weiten Mantel:
- Prinzipalgeschäfte: Der Jahresabschluss, die Anmeldung zum Register oder die Erteilung weiterer Prokuren bleiben dem Kaufmann persönlich vorbehalten.
- Grundstücksgeschäfte: § 49 Abs. 2 HGB entzieht Veräußerung und Belastung von Grundstücken der Prokura, solange keine zusätzliche Einzelermächtigung erteilt wird. Ob sich dieses Verbot auch auf schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäfte erstreckt, ist umstritten; die wohl h.M. bejaht dies, um Wertungswidersprüche zu vermeiden.
- Grundlagengeschäfte: Veräußerung des gesamten Handelsgeschäfts, Aufgabe des Betriebs oder Insolvenzantrag – der Prokurist ist nicht legitimiert, den Kaufmann existentiell umzuorientieren.
Beschränkungen außerhalb dieser katalogisierten Fälle bleiben innenrechtlich zulässig, entfalten jedoch keine Wirkung gegenüber Dritten (§ 50 Abs. 1 HGB). Das Herzstück der Prokura ist also ihre typisierte Außenvollmacht, geschützt nur durch Kollusions- und Missbrauchsvorbehalte.
2.3 Arten der Prokura
- Einzelprokura: Eine Person handelt alleine.
- Gesamtprokura (§ 48 Abs. 2 HGB): Zwei oder mehr Prokuristen vertreten nur gemeinsam. Eine gleichzeitige physische Anwesenheit ist nicht notwendig; es genügt, dass jede Erklärung mit Bezug auf dieselbe Rechtshandlung abgegeben wird.
- Unechte Gesamtprokura: Der Prokurist darf nur zusammen mit einem Organvertreter (z. B. GmbH-Geschäftsführer) handeln, während der Organvertreter alleinvertretungsbefugt bleibt. Das Gesellschaftsrecht – § 125 Abs. 3 HGB, § 78 Abs. 4 AktG – erkennt diese Mischform ausdrücklich an.
- Filialprokura (§ 50 Abs. 3 HGB): Bindung an eine oder mehrere Niederlassungen; im übrigen bleibt das Außenverhältnis unberührt.
2.4 Erlöschen der Prokura
Das Widerrufsprinzip (§ 52 Abs. 1 HGB) erlaubt jederzeitige Beendigung ohne besonderen Grund. Weitere Erlöschensgründe sind das Ende des Grundverhältnisses (Arbeits- oder Organvertrag), der Tod des Prokuristen, der Verlust der Kaufmannseigenschaft oder eine Unternehmensveräußerung. Stirbt dagegen der Inhaber, bleibt die Prokura gemäß § 52 Abs. 3 HGB bestehen, um die Handlungsfähigkeit des Nachlasses zu gewährleisten. Jede Beendigung ist registerrechtlich anzumelden; unterbleibt dies, schützt § 15 Abs. 1 HGB erneut den gutgläubigen Dritten.
2.5 Haftung bei Missbrauch und Überschreitung
Begeht der Prokurist ein Geschäft außerhalb seiner Macht, haftet er wie jeder Vertreter ohne Vertretungsmacht nach § 179 BGB. Liegt jedoch lediglich ein Innenmissbrauch vor – also Überschreitung interner Weisungen – bleibt das Geschäft gegenüber dem Dritten wirksam; allein das Innenverhältnis begründet Schadenersatz- oder Regressansprüche. Lediglich bei kollusivem Zusammenwirken oder grob fahrlässiger Evidenz kann das Rechtsgeschäft nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig sein oder der Dritte sich aus § 242 BGB nicht auf den Rechtsschein berufen.
3. Handlungsvollmacht – das flexible Pendant
3.1 Begriff und Einordnung
§ 54 HGB definiert die Handlungsvollmacht negativ: Jede im Betrieb erteilte Vollmacht, die keine Prokura ist. Die Stellschrauben lauten deshalb: Erteilung ohne Formerfordernis, erweiterungs- und beschränkbar, nicht registerfähig, rechtlich vor allem durch dispositive Normen geprägt.
Die Handlungsvollmacht spiegelt den Bedarf an flexiblen Delegationsmodellen: Sie erlaubt, die Kompetenzen passgenau zuschneiden, ohne den strengen Formalismus der Prokura übernehmen zu müssen.
3.2 Typen
- Generalhandlungsvollmacht: Ermächtigt zu allen Geschäften, die der Gesamtbetrieb gewöhnlich mit sich bringt.
- Arthandlungsvollmacht: Beschränkt auf Geschäfte einer bestimmten Art (z. B. Einkauf, Vertrieb, Personal).
- Spezialhandlungsvollmacht: Einmalige Einzeltransaktion.
Welcher Typ vorliegt, hängt von der Auslegung nach den §§ 133, 157 BGB ab; Abgrenzungsprobleme entstehen typischerweise bei wiederkehrenden Einzelgeschäften mittlerer Bedeutung.
3.3 Umfang und gesetzliche Restriktionen
§ 54 Abs. 2 HGB streicht vier Geschäftskategorien heraus, die der Vollmacht nicht unterfallen, sofern keine ausdrückliche Erweiterung erfolgt:
- Veräußerung oder Belastung von Grundstücken.
- Eingehung von Wechselverbindlichkeiten.
- Aufnahme von Darlehen.
- Prozessführung.
Diese Liste ist abschließend; anders als bei Prokura kann der Inhaber jedoch positiv jede Kategorie freischalten, etwa durch ein Formular „Handlungsvollmacht mit Darlehenskompetenz bis 250 000 €“. Eintragungspflichten bestehen nicht, in der Praxis sollte man gleichwohl präzise schriftlich dokumentieren, um Beweislastprobleme zu vermeiden.
3.4 Außenwirksame Beschränkung – § 54 Abs. 3 HGB
Der gravierende Unterschied zur Prokura liegt im Kennenmüssen der Beschränkung: Hat der Kaufmann intern den Darlehensspielraum seines Generalbevollmächtigten auf 50 000 € limitiert, bleibt ein 200 000 €-Darlehen nur wirksam, wenn der Darlehensgeber die Überschreitung nicht grob fahrlässig hätte erkennen müssen. Die Gerichte knüpfen die grobe Fahrlässigkeit an objektive Indizien – ungewöhnlich hohe Summen, falsche Funktionsbezeichnungen, Widersprüche zu Unternehmensgegenstand. Für Unternehmer bedeutet das: Je klarer die interne Kompetenzordnung nach außen sichtbar ist, desto leichter lässt sich eine grob fahrlässige Unkenntnis annehmen.
3.5 Untervollmacht und Übertragung
Der Handlungsbevollmächtigte darf seine Vollmacht ohne Zustimmung des Inhabers nicht übertragen (§ 58 HGB). Untervollmacht ist jedoch zulässig, wenn das gewöhnlicher Weise vorkommt – etwa wenn ein Einkaufsleiter Rahmenaufträge an Sachbearbeiter delegiert. Im Streitfall trifft die Darlegungs- und Beweislast den Geschäftsherrn, weshalb klare Anweisungen im Organisationshandbuch ratsam sind.
3.6 Erlöschen, Haftung und Gutglaubensschutz
Die Beendigung des Dienstverhältnisses zieht die Vollmacht grundsätzlich nach § 168 BGB nach sich; abweichende Regelungen sind möglich, werden aber eng ausgelegt. § 170 BGB schützt den gutgläubigen Dritten, solange die Kundgabe der Vollmacht nicht widerrufen wurde; § 173 BGB bewahrt ihn selbst nach Widerruf, wenn er ohne grobe Fahrlässigkeit keine Kenntnis erlangen konnte und der Inhaber unterlassen hat, den Rechtsschein zu zerstören. Anders als bei der Prokura kommt es also stärker auf die individuelle Kommunikationslage an.
4. Gesetzliche Rechtsscheintatbestände: § 56 und § 55 HGB
4.1 Die Ladenvollmacht – § 56 HGB
Wer in einem Laden oder offenen Warenlager arbeitet, gilt kraft Gesetzes als bevollmächtigt, alle gewöhnlichen Verkäufe und Empfangnahmen durchzuführen. Dabei ist unerheblich, ob die Person formal auf Lohnbasis angestellt, freiberuflich oder als Familienmitglied unentgeltlich aushelfen darf. Entscheidend ist allein der objektive Eindruck, den der Kaufmann gegenüber dem Publikum vermittelt.
Beschränkungen funktionieren nur durch klaren Hinweis – etwa „Zahlungen nur an der Hauptkasse“ oder „Unterschriften nur durch die Geschäftsführung gültig“. Fehlt ein solcher Hinweis, kann der Kaufmann später nicht einwenden, der Mitarbeiter sei nur Lagerist ohne Kassenvollmacht gewesen. Besonders in Zeiten des Online-Handels gewinnt § 56 HGB eine digitale Dimension: Auch ein Web-Chat-Mitarbeiter, der Bestellungen entgegennimmt, erzeugt einen Rechtsschein, wenn das Unternehmen nicht deutlich kommuniziert, dass Angebote erst nach Annahme durch die Zentrale bindend sind.
4.2 Außendienstvollmacht – § 55 HGB
Handlungsbevollmächtigte im Außendienst – ob selbstständige Handelsvertreter (§ 84 HGB) oder angestellte Reisende (§ 59 HGB) – genießen eine gesetzliche Abschlussvollmacht für alle Geschäfte der Art, deren Vermittlung ihr Auftrag ist. Allerdings enthält § 55 HGB zwei Korrektive:
- Abs. 2 und 3: Keine Änderung geschlossener Verträge und keine Annahme von Zahlungen ohne besondere Ermächtigung.
- Abs. 4: Erweiterung auf den Empfang von Mängelrügen und ähnlichen Erklärungen, damit der Prinzipal nicht den Kopf in den Sand stecken kann.
Für die Praxis sind zwei Punkte entscheidend: Erstens muss der Kaufmann seine Vertreter sorgfältig auswählen, weil er faktisch an deren Verhandlungsergebnisse gebunden bleibt. Zweitens sollte er interne Workflows einrichten, um fristgebundene Anzeigen (etwa nach § 377 HGB) schnell zu erfassen, die durch Außendienstler entgegengenommen wurden.
5. Rechtsschein- und Vertrauensschutz jenseits der Kataloge
Selbst wenn keine Prokura, Handlungsvollmacht oder gesetzliche Vermutung greift, kann der Kaufmann nach Duldungs- oder Anscheinsvollmacht haften. Das BGB enthält dafür keine Kodifikation; die Rechtsprechung entwickelt diese Institute aus § 242 BGB:
- Duldungsvollmacht: Der Vertretene weiß, dass jemand für ihn auftritt, schreitet aber nicht ein.
- Anscheinsvollmacht: Der Vertretene hätte bei gehöriger Sorgfalt erkennen können, dass der Rechtsschein entsteht, und hätte ihn verhindern können.
Im Handelsrecht sind solche Fälle häufig, wenn langjährige Mitarbeiter ohne formellen Titel faktisch alle Geschäfte abwickeln. Das Risiko lässt sich nur durch klare Organigramme, Vollmacht-Formulare und regelmäßige Schulungen minimieren.
6. Compliance- und Haftungsfragen in der Unternehmenspraxis
6.1 Registerpraxis und Corporate Governance
Die fehlerhafte oder verspätete Eintragung einer Prokura kann Organhaftung nach § 43 GmbHG oder § 93 AktG auslösen. Gleiches gilt für das Nichtmelden ihres Erlöschens. In größeren Gesellschaften gehört daher ein “Authority Matrix” zum internen Kontrollsystem: Sie verknüpft Prokura-Daten mit SAP-Berechtigungen, Bank-Signaturen und Access-Control.
6.2 Digitalisierung und Fernvertretung
Die Rechtsprechung erkennt elektronische Signaturen als taugliche Form für Prokura-Erteilungen an, solange die Identifizierung des Unterzeichners zweifelsfrei möglich ist. Bei Remote-Work muss der Kaufmann jedoch sicherstellen, dass ausschließlich autorisierte Nutzer Zugang zu Firmenportalen haben. Sonst droht eine Ausweitung der Anscheinsvollmacht.
6.3 Cross-Border-Konstellationen
Im Ausland ist das deutsche Register-Publizitätsprinzip nicht immer bekannt. Verträge mit ausländischen Partnern sollten daher eine Governing-Law-Clause und eine Representation Warranty enthalten, wonach der deutsche Vertragspartner ausdrücklich bestätigt, dass der Unterzeichner über ausreichende Vertretungsmacht verfügt.
6.4 M&A-Transaktionen
Beim Share-Deal bleibt die Prokura grundsätzlich bestehen, weil die Rechtspersönlichkeit unverändert fortbesteht. Beim Asset-Deal erlischt sie automatisch (§ 52 Abs. 2 HGB); der Erwerber muss neue Prokuren erteilen. Im Signing-Closing-Gap ist daher akkurat zu steuern, welche Vollmachten interimistisch gelten, etwa durch Transitional Services Agreements.
7. Praktische Empfehlungen für Unternehmen
- Schriftform nutzen: Auch wenn das Gesetz Formfreiheit zulässt, sollten Vollmachten klar schriftlich fixiert sein – inklusive Umfang, Beschränkungen und Erlöschensgründe.
- Register aktuell halten: Jede Erteilung, Änderung und Löschung einer Prokura sollte unverzüglich beim Register erfolgen. Verzögerungen können zu teurer Gutglaubenshaftung führen.
- Digitales Vollmacht-Register führen: Ein zentrales Tool vermeidet veraltete Bankunterschriften und erleichtert Audits.
- Mitarbeiterschulung: Wer kassiert, verkauft oder verhandelt, muss seine Grenzen kennen – und wissen, dass interne Überschreitungen arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
- Vertragsgestaltung: Aufnahme von Vertretungs-Garantien, Einsichtsrecht ins Handelsregister oder Vorlage aktueller Prokura-Liste kann Risiken in Verhandlungen reduzieren.
- Notfallregeln: Für Krankheit oder plötzlichen Ausfall eines Prokuristen sollten Eventual-Vollmachten vorbereitet sein, um Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
9. Fazit
Die handelsrechtlichen Stellvertretungsregeln sind ein klassisches Beispiel dafür, wie das HGB das Spannungsfeld zwischen Verkehrsschutz und Unternehmerfreiheit löst: Die Prokura liefert maximale Handlungsvollmacht bei minimaler Publizität, während die Handlungsvollmacht flexible Delegationsmöglichkeiten schafft, ohne den Rechtsverkehr schutzlos zu lassen. Ergänzende Rechtsscheintatbestände schließen Lücken und halten den Geschäftsverkehr flüssig.
Für die Praxis bleibt jedoch klar: Compliance beginnt bei der Vollmacht. Wer Prokuren leichtfertig erteilt, Registerpflichten ignoriert oder interne Beschränkungen nur mündlich ausspricht, riskiert erhebliche Haftungsfolgen. Umgekehrt nutzen Unternehmen, die ihre Vollmachtsstrukturen transparent gestalten, digitale Register führen und ihre Belegschaft schulen, die Vorteile des Handelsrechts voll aus: schnell, professionell und rechtssicher zu agieren. Unsere Kanzlei Hobohm Natalello Giloth unterstützt Sie dabei gern – von der Gestaltung Ihrer Organisations- und Vollmachtsrichtlinien bis zur Vertretung in streitigen Auseinandersetzungen.
Ihre Ansprechpartner
Rechtsanwältin Sinem Tükek und Rechtsanwalt Dr. André Natalello
Telefon: 06131-9725322
E-Mail: info@hng.law
Standorte: Mainz | Alzey
Termine nach Vereinbarung – auch kurzfristig möglich
Hobohm Natalello Giloth – Rechtsanwälte seit 1959
Terminvereinbarung
Terminvereinbarungen mit der Kanzlei sind unproblematisch auch per WhatsApp möglich. Bitte beachten Sie jedoch, dass über WhatsApp ausschließlich die Terminvereinbarung erfolgt.
KONTAKTFORMULAR
Zur Vereinbarung eines Termins mit der Kanzlei Hobohm Natalello Giloth können Sie im Übrigen auch das Kontaktformular verwenden. So kommen Sie schnell und einfach zu Ihrem Termin in der Kanzlei
Selbstverständlich können Sie Termine mit Ihrem Anwalt auch per E-Mail vereinbaren. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail bietet es sich an, wenn Sie den Sachverhalt bereits grob skizzieren.